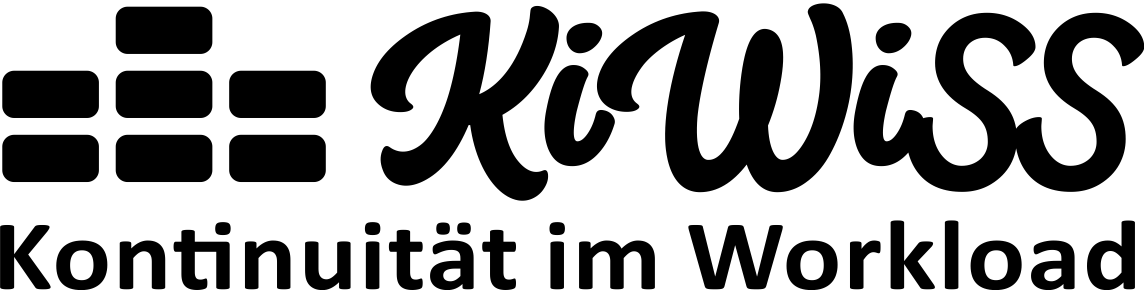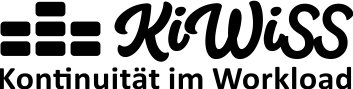Von KiWiSS 15. Januar 2025
Lernstrategien
Lernstrategien beschreiben Verhaltensweisen wie etwa Lernformen, Lernstile und Lernfertigkeiten sowie Kognitionen, die gezielt den Erwerb von Wissen beeinflussen. Oftmals werden Lernstrategien mit kognitiven Fähigkeiten verbunden, die v. a. den Umgang mit neuen Informationen beim Lernen beschreiben. Allerdings findet durch Lernstrategien eine Steuerung von Lernprozessen statt (vgl. Friedrich & Mandl, 2006), wodurch auch persönliche Zielsetzungen, Motivation und damit auch affektive Handlungen zum Tragen kommen. (vgl. Wild & Schiefele, 1994; Wild, 2005)
Lernstrategien sind im (Selbst)-Studium zentral und im Sinne der Selbstregulation als nicht-kognitive Fähigkeit neben den kognitiven Fähigkeiten wichtig für den Studienerfolg (vgl. Stone, 2021). Aus diesem Grund ist die Förderung von Lernstrategien bei Lernenden von essentieller Bedeutung.
In der Literatur werden Lernstrategien oftmals in kognitiv, metakognitiv und ressourcenbezogen Lernstrategien unterteilt. Lesperance et al. (2023) geht ausgehend von dem drei Schichten Modell von Boekerts zum selbstregulierten Lernen von einer weiteren Kategorie aus, die sich auf motivational-affektive Lernstrategien bezieht (siehe die Abbildung unten).

Unter kognitiv Lernstrategien verstehet man Wiederholungsstrategien, Organisationsstrategien, Elaborationsstrategien, und Kritisches Denken, welche zur Informationsaufnahme, -verarbeitung, und -speicherung eingesetzt werden (vgl. Schiefele & Wild, 1994). Jede dieser Lernstrategie ist für unterschiedliche Zwecke besonders gut geeignet, wobei sich diese oftmals gegenseitig bedingen. So dienen Wiederholungsstrategien meist zum Auswendiglernen von Fakten, Organisationsstrategien zur zugänglichen Veranschaulichung von Informationen und Elaborationsstrategien zur Verknüpfung von neuem Wissen mit dem eignen Vorwissen. Kritisches Denken/Prüfen erfordert ein gewisses Verständnis und trägt zur dessen Vertiefung bei, weshalb es auch als eine Form von Elaborationsstrategien ist (vgl. Wild, 2005).
Metakognitive Lernstrategien sind jene, die den Lernprozess kontrollieren (vgl. Schiefele & Wild, 1994). Das Lernen wird zunächst durch eine Zielsetzung und Auswahl passender kognitiver Lernstrategien geplant (Planungsstrategien). Dabei werden während dem Lernen die eigenen Lernfortschritten überwacht (Monitoring-Strategien) und nach dem Lernen evaluiert (Evaluationsstrategien). Zudem wird der eigene Lernprozess über Anpassung der Lerntätigkeit reguliert (Regulationsstrategien) (vgl. Wild, 2005; Lesperance et al., 2023).
Ressourcenbezogene Lernstrategien wirken unterstützend auf den Lernprozess. Dabei wird zum einen in innere Ressourcen unterschieden, welche das eigene Management (Anstrengung, Zeitbudget und Aufmerksamkeit/Konzentration) umfassen. Zum anderen werden als externe Ressourcen z. B. die Nutzung von weiterer Literatur und die Gestaltung sowie Wahl der Lernumgebung mit oder ohne Arbeitsgruppe gesehen (vgl. Schiefele & Wild, 1994; Wild, 2005).
Motivational-affektive Lernstrategien greifen auf das Selbstkonzept der Lernenden zurück, da Emotionen und v. a. auch Motivation eine wichtige Rolle bei kognitiven und metakognitiven Lernstrategien einnehmen (vgl. Landmann et al, 2009; Lesperance, 2023). Über Identifikationsstrategien wird eine Art Belohnung erkannt, mit der der Aufwand gerechtfertigt wird. Die Motivation wird auch durch konstruktiv kritischen Umgang von Erfolg und Misserfolg beeinflusst. Lernende sollten ihre Leistungen im Zusammenhang mit den verwendeten kognitiven und metakognitiven Lernstrategien einsehen können. Hierbei kann das Feedback von einer Lehrkraft bzw. von Lehrenden dazu verhelfen den Lernprozess genauer zu verstehen und damit auch die Motivation zu steigern (Feedback-Strategien) (vgl. Lesperance, 2023).
Literatur:
Friedrich, H. F. & Mandl, H. (2006). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In H. Mandl & H. F. Friedrich (Hrsg.), Handbuch Lernstrategien. Göttingen: Hogrefe, S. 1–23.
Landmann, Meike; Perels, Franziska; Otto, Barbara; Schmitz, Bernhard (2009): Selbstregulation. In: Wild, Elke; Möller, Jens (2009): Pädagogische Psychologie. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, S. 49–70. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88573-3_3
Lesperance, Kaley; Holzmeier, Yvonne; Munk, Simon; Holzberger, Doris (2023): Selbstreguliertes Lernen fördern: Lernstrategien im Unterricht erfolgreich vermitteln. Wissenschaft macht Schule. 6. Auflage. Münster: Waxmann.
Schiefele, Ulrich; Wild, Klaus-Peter (1994): Lernstrategien im Studium: Ergebnisse zur Faktorenstruktur und Reliabilität eines neuen Fragebogens. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 15/4. Potsdam: Universität Potsdam, S. 185-200.
Stone, David C. (2021): Student success and the high school-university transition: 100 years of chemistry education research. In: The Royal Society of Chemistry. Chemistry Education Research and Practice 22, S. 579-601. https://doi.org/10.1039/d1rp00085c
Wild, Klaus-Peter (2005): „Individuelle Lernstrategien von Studierenden. Konsequenzen für die Hochschuldidaktik und die Hochschullehre“. Beiträge zur Lehrerbildung 23, Nr. 2, S. 191–206. https://doi.org/10.25656/01:13572