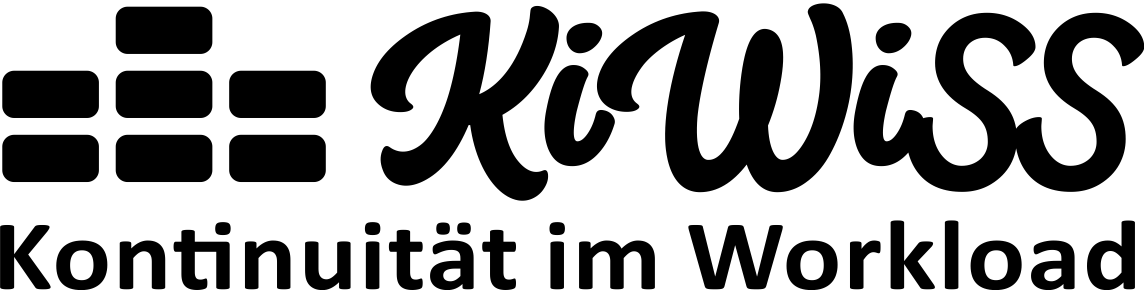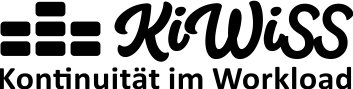Von KiWiSS 22. Dezember 2024
Erfahrungen und Gedanken zu Selbstlernzeiten – Erfahrungen von Studierenden in Reaktion auf den KiWiSS Beitrag der TURN Conference 2024
In Reaktion auf den KiWiSS Beitrag auf der TURN Conference 2024 berichten Leon Richter und Johann-Nikolaus Seibert nun im Austausch mit Studierenden über die Erfahrungen der Studierenden zum Selbststudium.
Bisher wurde von uns zumeist auf die wissenschaftliche Literatur und die Erfahrung anderer Forscherinnen und Forscher geschaut, denn diese bietet Evidenz und Orientierung für mögliche temporäre Reaktionen auf einen erhöhten Studienabbruch und weiteren Aspekten in der Studieneingangsphase, welche zum Studienerfolg oder -misserfolg führen können. Wenn das Studium verbessert werden soll, müsen wir stärker das Studium als gesamte Lerninstitution mit all ihren Akteuren in den Blick nehmen und die Studierenden und ihre ganze eigene Sicht miteinbeziehen. Daher sind die Erfahrungen von Studierenden zu ihrem Selbststudium besonders wichtig.
Im Folgenden werden ausgewählte Aspekte und Statements der Studierenden aus der Diskussion des Vortrags herausgegriffen und kurz kommentiert. Alle Studierenden wurden gebeten ihre Zufriedenheit mit ihrem Selbststudium auf einer Skala von 1 (nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) anzugeben.
Kommentar 1 (Bachelorstudent): Der Student sagt, dass seiner Erfahrung nach die Studierenden oft nicht die Zeit für das Selbststudium haben, d. h. die Zeit, die eigentlich von den Studienanforderungen von ihnen verlangt wird. Er sagt, dass es durch das Präsenzstudium oder durch das Leben im Allgemeinen viel zu tun gibt (dieser Student ist ehrenamtlich tätig). Der Student sagt auch, dass er nicht wirklich Lernstrategien hat, die er anwendet. Wenn er Zeit hat und etwas tut, dann tut er es ohne großen Plan und ohne es im Nachhinein zu überprüfen. Er meint, dass ihm diese Lernstrategien nicht so bewusst sind, weil er sie schon seit der Schule hat. Er führt dazu aus, dass er sich unter Lernstrategien immer große abstrakte Strategien vorgestellt hat und in diesem Sinne nicht alles, was er macht, sei es eine To-Do-Liste für den Tag zu schreiben oder verschiedene Handyalarme einzustellen, als Lernstrategie ansieht. In Bezug auf die Techniken, die er anwendet, sagt er, dass er sie nicht immer gleich anwendet, sondern immer variiert. Einstufung: 5-6
Aus dieser Erfahrung des Studenten werden verschiedene Aspekte ersichtlich. Einerseits, dass es im Studium andere Belastungsquellen gibt, als nur die universitären Belastungsquellen, wie Studienorganisation, Vorlesungsinhalte, Übungsblätter, Studienbezogene Selbstregulation, Prüfung(-svorbereitung) etc. So führen globale Belastungsquellen (bspw. Studienfinanzierung, Work-Life-Balance), private Belastungsquellen (bspw. Alltagsanforderungen, privates soziales Umfeld) und sonstige Belastungsquellen, welche explizit nicht zu den universitären Belastungsquellen gehören, dazu, dass die Studierenden mit ihrer zur Verfügung stehenden Zeit jeweils haushalten müssen und sie vielleicht weniger Zeit in ihr Vollzeit-Studium investieren, als es eigentlich veranschlagt wird. Andererseits wird ersichtlich, dass viele Studierende bzw. Lernende im Allgemeinen nicht wissen, was Lernstrategien sind und wie sie eingesetzt werden können. Das ist sicherlich auch kein Wunder, wenn Lernstrategien den Lernenden abstrakt dargebracht werden, indem sie definiert und in erziehungswissenschaftliche Theorien eingebettet werden sowie den Lernenden nur abstrakte Klassifikationen von kognitiven Lernstrategien, über metakognitive und ressourcenbezogene bis hin zu motivational-affektiven Lernstrategien als Einordnung und Berührungspunkt mit Lernstrategien gezeigt werden. Hierbei müsste in der Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Thema der Lernstrategien handlungsnah gearbeitet werden. Genau dieser handlungsnahe Aspekt ist schon seit Jahren ein großer Kritikpunkt an Testinstrumenten wie dem „Lernstrategien im Studium“ (kurz: LIST) Fragebogen, welcher abstrakte Prozesse als Lernstrategien abfragt. Denn viele Lernende haben individuell eigene Lernstrategien, die sie selbst nicht als Lernstrategien begreifen, aber dennoch als Lernstrategien einzuordnen sind. Daher sollten Lernstrategien handlungsnah beschrieben und an vielen Beispielen dargestellt werden. Die Lernenden müssen sich bewusst machen, dass sie eine Lernstrategie verwendet, obwohl das, was sie machen keinen tollen Namen trägt wie ALPEN-Methode oder Eisenhower-Matrix.
Kommentar 2 (Masterstudentin): Diese Studentin organisiert ihr Selbststudium. Sie gibt an, dass sie sich einen Überblick über alle zu erledigenden Studienleistungen verschafft und sich eine To-Do-Liste mit Terminen und Fristen erstellt. Sie versucht auch, ihre Tage damit zu planen, gibt aber zu, dass sie sich oft zu viele Aufgaben vornimmt. Sie betont, dass es ihr sehr wichtig ist, kontinuierlich zu arbeiten. So möchte sie nicht drei Wochen lang nichts tun, um nicht mit dem Lernen in Rückstand zu geraten. Zu ihren beiden Fächern sagt sie, dass sie je nach Fach unterschiedlich lernt. Für manche Vorlesungen müssen Inhalte auswendig gelernt werden und dafür macht sie sich Karteikarten, Lernzettel und Zusammenfassungen, die im Laufe des Semesters immer mehr werden. Ansonsten, z. B. bei Vorlesungen mit Übungsaufgaben, bearbeitet sie die Übungsaufgaben und rechnet sie durch, um so in das Lernen für diese Vorlesung hineinzukommen. Einstufung: 8 – im Anschluss an ihre Einstufung erklärt sie, dass sie durch das Selbststudium immer zufriedener mit ihrem bisherigen Studium geworden ist und es jetzt ganz anders ist als am Anfang.
Diese Erfahrung zeigt, dass das Selbststudium kein statisches Objekt ist, sondern eher als ein aktiver und wandelbarer Prozess zu betrachten ist. Alle Lernenden - das schließt auch Promovierende, Postdocs sowie Professorinnen und Professoren mit ein – sind nicht mit einem perfekten Handeln im Selbststudium in das Studium gestartet. Nach der Meinung des KiWiSS-Teams besteht der Prozess der Kompetenzentwicklung zum Selbststudiums auch aus Versuch und Irrtum (Trial and Error), bei der unterschiedliche Möglichkeiten des Selbstlernen solange ausprobiert werden, bis eine für sich selbst geeignete Lösung gefunden wird. Dabei vergessen manchmal viele, dass eben das Scheitern fundamental zu diesem Prozess gehört – es mag sich schlecht anfühlen, wenn eine bestimmte Möglichkeit des Selbstlernens nicht funktioniert, aber das eröffnet neue Erkenntnisse und Wege für weitere und vielleicht geeignetere Möglichkeiten. Diese Masterstudentin wendet schon viele Lernstrategien an, um ihren individuellen Studienalltag und ihr Selbststudium zu organisieren. Hierbei betont sie besonders, dass ihr das kontinuierliche Lernen während des Semesters wichtig ist. Da sie nun mit ihrem Selbststudium zufriedener ist als am Anfang, kann angenommen werden, dass sich eben mit verschiedenen Anläufen ihre derzeitigen Strategien etabliert haben. Besonders ihr Vermerk „damit es nicht mit dem Lernen hinten raus eng wird“ zeugt davon, dass solche zeitlich engen Lernsituationen schon erlebt und für sich als negativ bewertet wurden.
Kommentar 3 (Bachelorstudentin): Die nächste Studentin stimmt ihrer Vorrednerin in vielen Punkten zu. Sie betont hier, dass das Selbststudium für sie ein Prozess sei. Sie ist der Meinung, dass sich die Strategien aller Studierenden im Laufe der Zeit ändern, d. h. wenn man merkt, dass das reine Auswendiglernen nichts bringt, weil man am Ende nicht mehr so viel behalten kann, ändert man seine Vorgehensweise. Sie erwähnt auch, dass die Art des Selbststudiums stark vom Fach abhängt. So musste sie in einem Fach sehr viel auswendig lernen, weil man dort Inhalte wissen muss, um dieses Wissen mit anderen Inhalten verknüpfen zu können. Daraus schließt sie, dass man für sich selbst einen Kompromiss beim Selbststudium und den eigenen Lernstrategien finden muss, welche sinnvoll sind, welche man anwenden sollte und welche zum Fach passen. Abschließend sagt sie, dass sie Lehrveranstaltungen, in denen während des Semesters verpflichtend etwas abgegeben werden muss, wie z. B. Übungen, am besten findet, da dies für sie die Kontinuität fördert. Einstufung: 6
Hier benennt diese Studentin den oben bereits angesprochenen Punkt, dass das Selbststudium ein Prozess ist. Genau hier spricht sie mit ihrem Beispiel zum Auswendiglernen ohne Erflog den Trial and Error-Prozess des Selbststudiums an, welcher mit einer Reflexion der Lernenden über ihren Lernprozess und dessen Lernerflog verknüpft ist. Die Erfahrungen der Studierenden aus Kommentar 2 und 3 sprechen dabei an, dass sie für sich erkannt haben, dass das Lernen, die Lernstrategien und damit auch die Art des Selbststudiums vom Fach, bzw. kleinschrittiger gedacht, von der Lehrveranstaltung abhängt. Solche Erfahrungen zeugen von einem aktiven und wandelbaren Prozess des Selbststudiums sowie der Reflexion der Studentinnen über ihre Strategien und die jeweilige Passung mit dem zu lernenden Material. Hieraus ergibt sich besonders interessanter Punkt: Die Studierenden müssen beim Selbststudium und den eigenen Lernstrategien im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Lehrveranstaltungen für sich selbst einen Kompromiss finden. Dahingehend gilt es die Studierenden bei diesem Prozess didaktisch zu begleiten, indem ihnen Lernstrategien niederschwellig und handlungsnah aufgezeigt werden, welche passend für das Lernen im Studium sind und, indem die nötigen Kompetenzen zur Reflexion angebahnt werden, um solche Kompromisse finden zu können. Für die Förderung dieser Lernstrategie- und Reflexionskompetenzen braucht es mehrere redundante Zugänge, bis diese von den Lernenden auch beherrscht werden und angewendet werden können. Durch die Reflexion wird zuweilen auch deutlich, ob die (Lern-)Ziele und Absichten richtig verstanden sind und ob der richtige Fokus auf die Bemühungen gelegt wurde.
Kommentar 4 (Bachelorstudentin): Der große Punkt, den diese Studentin beim Selbststudium anmerkt, ist, dass sie immer unterschätzt, wie viel Zeit man für was braucht. Mit WAS meint sie z. B. die Nachbereitung einer Vorlesung oder das Lernen für eine Prüfung. Sie sagt, dass sie sich für das Selbststudium einen Plan macht, den sie aber meistens nicht einhalten kann. Daraus schließt sie, dass die realistische Zeiteinteilung bei ihr noch nicht so gut funktioniert. Einstufung: 5
Das Zeitmanagement ist eine große „Baustelle“ bei vielen. Bereits im zweiten Kommentar hat die Studentin angesprochen, dass sie sich meist zu viel für einen Tag vornimmt. Solche Baustellen sind okay und völlig normal. Menschen funktionieren nicht wie getaktete Roboter, die perfekt abschätzen können wie viel Zeit für welche Aufgabe benötigt wird, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. In unserer Bearbeitung von Aufgaben weichen wir auch oft vom geplanten Weg ab, weil uns z. B. etwas auffällt, was zu dieser Aufgabe passt und wir zusätzlich verfolgen oder, weil die Bearbeitung nicht so einfach war, wie anfangs gedacht. Im Prozess des Selbstlernens gehört all dies dazu und mit der eigenen Erfahrung um sich selbst im Lernprozess entwickelt sich auch die eigene Fähigkeit Aufgaben zeitlich realistisch einzuschätzen. Dahingehend ist es ebenfalls wichtig bei den Studierenden nicht nur lernstrategische und reflektorische Kompetenzen fördern zu wollen, sondern sie auch zu sensibilisieren, welche Baustellen und besonders auch welche Gefühle a) zum Übergang Schule–Hochschule bzw. Semesterstart und b) zum Selbststudium dazugehören, die von jeweils individuell zu meistern sind. Lehr-Lernsetting wie es Lehrveranstaltungen an Universitäten sind, können keine Einheitslösung für alle finden und anbieten, weshalb das individuelle Meistern solcher Aufgaben gemäß der eigenen Personenmerkmale wichtig ist.
Kommentar 5 (Masterstudentin): Diese Studentin berichtet aus ihrer Erfahrung, dass der Arbeitsaufwand für manche Lehrveranstaltungen unverhältnismäßig war: Bei manchen Lehrveranstaltungen stimmte die Anzahl der Leistungspunkte bzw. ECTS nicht mit dem Arbeitsaufwand überein – d. h. in manchen Lehrveranstaltungen musste für die gleichen Leistungspunkte deutlich weniger oder auch mehr getan werden als in anderen Lehrveranstaltungen mit der gleichen Anzahl an ECTS. Sie meinte daher, dass die Semesterplanung für sie schwierig war, da sie nicht abschätzen konnte, wie viel Zeit sie tatsächlich im Selbststudium für die einzelnen Veranstaltungen benötigte. Des Weiteren gab sie den Tipp, dass im Studium nie die schwierigen Prüfungen auf das nächste Semester verschoben werden sollten, leichte Prüfungen hingegen schon. Sie sagt, dass man schauen sollte, dass die schweren weg sind. Sie begründet dies damit, dass wenn man die schwierigen Prüfungen ins nächste Semester verschiebt, der Schwierigkeitsgrad der Prüfung nicht sinkt und somit auch nicht die Lernzeit und damit die zugehörige Motivation sinkt. Auch sie gibt an, dass ihre Anwendung von Strategien vom Fach abhängt. Einstufung: 8
Diese Erfahrung bzgl. den sich zwischen Lehrveranstaltungen unterscheidenden Workloadverteilungen zeigt, dass eine Diskrepanz besteht zwischen den akkreditierten ECTS Leistungspunkten und den jeweiligen zu erbringenden Leistungen. Dies ist aber ein institutionelles Problem. Auch wird aus dieser Erfahrung deutlich, dass Kontinuität, die mit dem KiWiSS-Projekt bei Studierenden gefördert werden soll, auch in Lehrveranstaltungen vorgelebt werden sollte. Im zweiten Punkt, den sie aus ihrer Erfahrung anspricht, gibt sie einen erfahrungsbasierten Tipp für das eigene Studium. Hieraus wird deutlich, dass die Studierenden, welche bereits in ihrem Studium fortgeschritten sind, passende und aus ihrer Erfahrung her bewährte Tipps für Studienanfängerinnen und -anfänger haben können.
Auffällig scheint im Austausch mit den fünf Hilfskräften , dass die beiden Masterstudentinnen angeben, mit ihrem Selbststudium zufriedener zu sein als die drei Bachelorstudierenden.