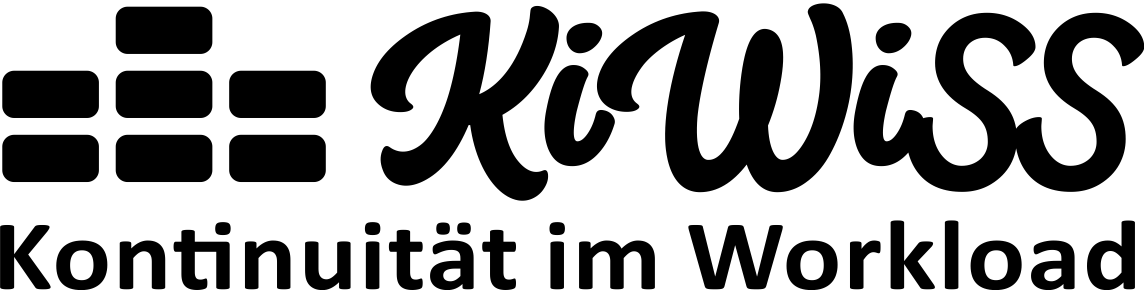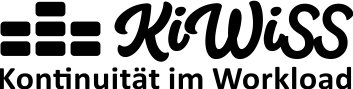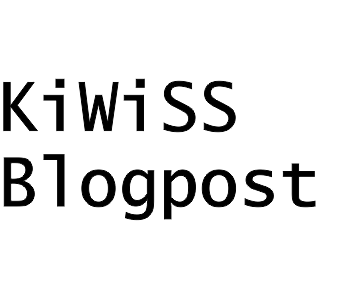Selbstüberprüfende PDF-Arbeitsblätter
Selbstüberprüfende Arbeitsblätter als Unterstützungsmaterial im Selbstlernprozess Selbstorganisierte Lernprozesse benötigen Feedback. Gerade im Selbstlernprozess reduziert dies Unsicherheit und zeigt bei der Überprüfung von ausgewählten Aufgaben, ob ein Lernerfolg vorliegt bzw. inwiefern der Lerngegenstand in adäquater Weise durchdrungen wurde. Entsprechend hat das Bearbeiten von Übungsblättern mit Musterlösungen in vielen naturwissenschaftlichen Fächern eine lange Tradition beim Lernen. In reformpädagogischen Ansätzen wird dem Lernmaterial eine hohe Bedeutung zugesprochen insbesondere, wenn die Überprüfung einer Lernaufgabe selbstständig und in eigenem Tempo durchgeführt werden kann und die Lösung bereits dem Lernmaterial inhärent ist.